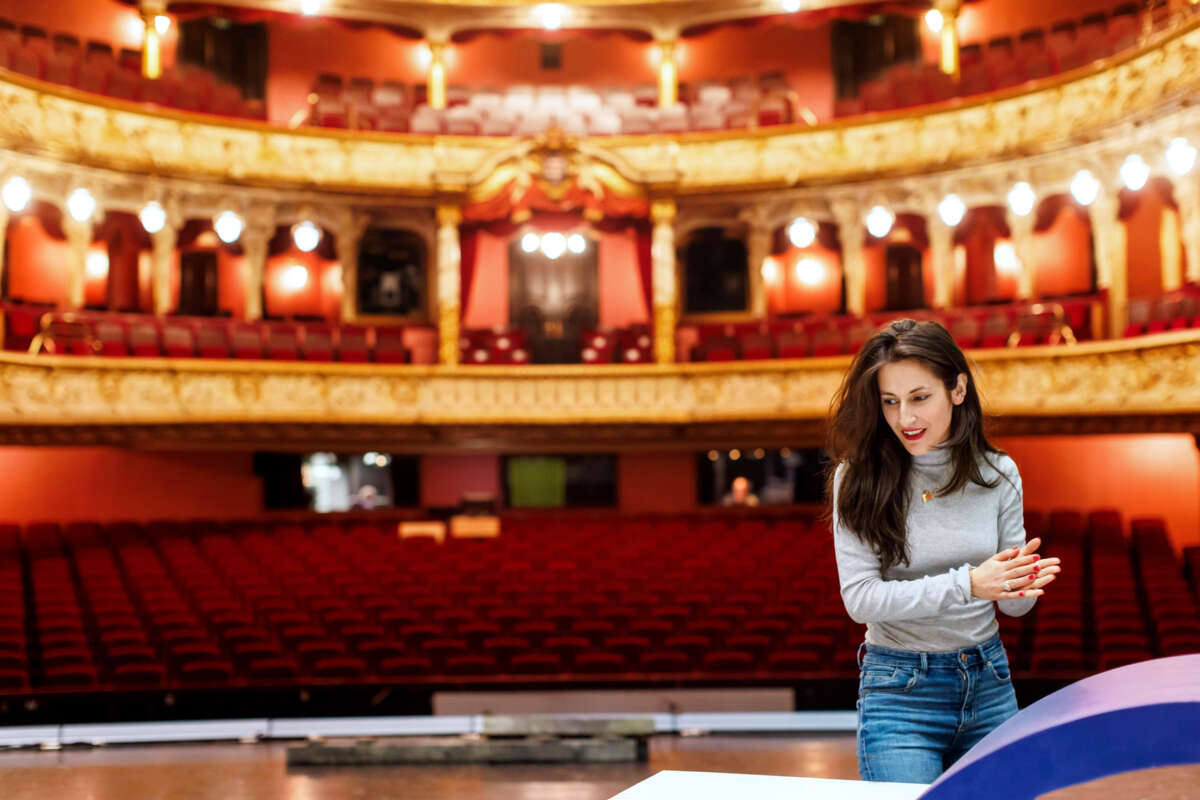Arien wie Pop-Hits und die größte Finalszene der Operngeschichte
Der eine Regisseur wurde in der französischen Provinz entdeckt. Der andere wird zu Mozarts Musik tektonische Verschiebungen zaubern. Dazu kommen Besetzungen wie aus der Wundertüte. Bogdan Roščić erklärt das Opernprogramm 2022/23.

Foto: Lukas Gansterer
Auch in der Hochkultur ist Platz für Banales. „Sag Bogdan, dass er zu dünn ist. Er muss mehr essen.“ Wir treffen Starregisseur Calixto Bieito zufällig beim Bühneneingang. Er ist gut gelaunt und grinst. Der Katalane kommt gerade von einer Besprechung mit dem Staatsoperndirektor. Bieito wird die erste Neuproduktion der kommenden Saison inszenieren. Er hätte also eben genug Gelegenheit gehabt, seine Botschaft bei Roščić zu deponieren. Aber nachdem er es nicht getan hat, lassen auch wir es. Aus Höflichkeit, weil es unpassend wäre, oder was meinen Sie?
„Von der Liebe Tod“ heißt die Produktion. Gustav Mahler, der keine Oper hinterlassen hat, bekommt jetzt posthum eine. „Das klagende Lied“ und die „Kindertotenlieder“ werden von Bieito zu einem „Bühnenwerk“ verzaubert, und Florian Boesch wird endlich im Haus am Ring singen, wie uns Roščić später erzählen wird.
Wir haben für Sie den Direktor getroffen und mit ihm über Inhalte und Hintergründe des neuen Programms gesprochen. Und warum das 125-jährige Dienstantrittsjubiläum von Mahler „nur eine Zahl“ ist, aber eine, „die genug Stoff bietet und genauer beobachtet werden kann“, wie Bogdan Roščić sagt.
Zur Person: Bogdan Roščić
Seit der Saison 20/21 ist der studierte Philosoph & Musikwissenschaftler Roščić Direktor der Wiener Staatsoper. In dieser Zeit führte er das Haus erfolgreich durch die Pandemie und wieder zurück an die Spitze der Opernwelt. Besonders erfolgreich ist sein U27-Programm, mit dem er junges Publikum ins Haus holte. Roščić ist verheiratet und hat drei Kinder.
„Er gerät in einen Streit mit der Materie; die Trägheit, der Halbverstand, der Missverstand setzen sich ihm entgegen“, schrieb Hofmannsthal über den Operndirektor. Fühlen Sie sich auch manchmal so?
(Lacht.) Nein. Er sprach ja von Mahler und von ganz spezifischen Umständen. Aber Veränderung löst immer irgendeinen Widerstand aus, darüber muss man nicht gleich jammern. Thomas Bernhard schreibt irgendwo, nur ein Wahnsinniger verlangt ständig die komplette Verwirklichung seiner Idealvorstellungen. Darum bescheide ich mich ja auch mit 99 Prozent.
Florian Böschs Hausdebüt
Ihr Mahler-Jubiläum 125 Jahre nach dessen Amtsantritt wirkt ein bisserl konstruiert.
Mahlers Geschichte an der Wiener Oper ist etwas so Faszinierendes, Einzigartiges, das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Allein der Kampf um seine Identität: Als Direktor der Hofoper stand er sozusagen an der Spitze der damaligen Musikwelt und war doch zum Ferialkomponisten degradiert. Es ist völlig rätselhaft, wie er das alles bewältigt hat: Er hat hundert und mehr Abende pro Saison selbst dirigiert, die Oper geleitet und auch noch reformiert – und dann eben in der Sommerfrische diese gigantischen Werke geschaffen.
Mahler hat keine Opern hinterlassen, also basteln Sie ihm jetzt eine und bauen aus „Das klagende Lied“ und den „Kindertotenliedern“ ein Bühnenwerk zusammen.
Wir „basteln“ gar nichts, sondern kauen an dem Rätsel, dass ausgerechnet ein Mensch, der ein genialer Komponist war und sein Leben der Oper gewidmet hatte, keine Oper hinterlassen hat. Gleich bei seinem Opus 1 kam er einer solchen aber sehr nahe, das Libretto von „Das klagende Lied“ ist opernhaft und auch sehr Wagner-artig, es ist sehr effektvoll inszenierbar. Die „Kindertotenlieder“ schließen den Kreis. Calixto Bieito ist obsessiver Mahler-Fan und der ideale Regisseur dafür. Und dann bringt diese Produktion auch ein wichtiges Hausdebüt: Dass ein Sänger von der Qualität und der Weltkarriere des Florian Boesch hier noch nie gesungen hat, ist skurril.

Foto: Lukas Gansterer
Die „Meistersinger“ und „Salome“
Danach kommen Wagners „Meistersinger“.
Philippe Jordan und ich wollen ja das zentrale Wagner-Repertoire neu erarbeiten, szenisch wie musikalisch. Aber die „Meistersinger“ gehören nicht zu den Werken, die man immer sehr gut besetzen kann. Man darf das nur machen, wenn alle Positionen erstklassig sind. Wir haben in dieser Neuproduktion drei Sänger, die in der Rolle des Hans Sachs international gefeiert wurden: Michael Volle als unseren Sachs, Wolfgang Koch als Beckmesser und Georg Zeppenfeld als Pogner.
Allein wegen der musikalischen Konstellation muss man das machen. Dass Wagner für Mahler und seine Generation das zentrale Erlebnis war und die „Meistersinger“ dabei eine besondere Stellung hatten, kommt dazu. Und mit Keith Warner gibt auch noch ein Regiemeister sein sehr spätes Hausdebüt. Die „Meistersinger“ haben politisch problematische Aspekte, das ist zu verarbeiten. Gleichzeitig müssen sie großes Theater sein, man muss diese ungeheuren Massenszenen spektakulär machen. Und dann muss auch die unwiderstehliche Komik herauskommen. Warner bringt das alles mit.
In der Pampa bei Paris
Große Regienamen haben die vergangene Saison geprägt. Dieses Mal versucht sich mit Cyril Teste ein Regisseur an „Salome“, der bislang nur in Frankreich auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch durch seine spektakuläre Hermès-Modenschau.
Wir kannten Teste alle miteinander nicht. Ein Kollege hatte in Paris aus purem Zufall eine Inszenierung gesehen. Er war so begeistert, dass wir begonnen haben, Teste intensiver zu beobachten. Ich erinnere mich an einen knallvollen Theaterabend mit Isabelle Adjani, in irgend so einer riesigen Mehrzweckhalle mitten in der Pampa bei Paris. Da kamen wir ins Gespräch und auf „Salome“.
Teste sagt: „Meine Arbeit ist kein Theater. Sie ist Film in Echtzeit.“ Wird so die „Salome“?
Das bedeutet bei Teste zunächst einmal grandiose Personenführung bis ins Detail statt Abspulen von Standardgesten. Aber Teste wird auch mit Live- Video arbeiten. Ein Stilmittel, das nur dann legitim ist, wenn dadurch Dinge sichtbar und erlebbar werden, die das Publikum sonst nicht mitbekommt. Aber Teste ist ganz und gar Bühnenkünstler. Ich darf nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel löst er den Schleiertanz auf eine mich tief berührende, mir so noch nicht bekannte Weise, die völlig zwingend aus dem Zentrum seiner Interpretation kommt. Und mit Malin Byström erlebt Wien eine neue Salome.
Ich glaube, es wird ein echtes Theaterfest.
Bodgan Roščić
Wiedersehen mit Barrie Kosky
Bei Mozarts „Le nozze di Figaro“ schlägt wieder Barrie Kosky zu. Wird es wieder so körperlich wie bei seinem „Don Giovanni“?
Ich glaube, es wird ein echtes Theaterfest. Bei „Don Giovanni“ hat Barrie ja einen fast abstrakten Raum verwendet, jetzt wird es das Gegenteil. Völlig konkrete, brillant gebaute häusliche Räume, durch die die Handlung wie eine einzige kontrollierte Explosion rollt. Die verschiedenen Paare der Handlung nennt er „tektonische Platten“, die sich ja bei Bewegung so lange aneinander reiben, bis es zum Erdbeben kommt. Das „Figaro“-Libretto hat ja im Gegensatz zum viel rätselhafteren, uneindeutigeren „Don Giovanni“ auch eine virtuos boulevardeske Komponente. Nur dass es von dieser immer wieder unfassbaren Musik in eine andere Dimension gehoben wird. Dazu haben wir das Glück einer fantastischen jungen Besetzung, die das alles auch mit dem nötigen Glamourfaktor darstellen kann.
Die Latte muss immer hoch liegen. Schon damit man im Notfall untendurch gehen kann.
Bodgan Roščić
Mit „Il ritorno d’Ulisse in patria“ vollenden Sie den Monteverdi-Zyklus. Nach den Erfolgen der vergangenen Produktionen liegt die Latte hoch.
Die Latte muss immer hoch liegen. Schon damit man im Notfall untendurch gehen kann. (Lacht.) Aber für die „Poppea“ wurde mir ja von manchen, die sich nach dem Publikumsjubel offenbar nicht mehr daran erinnern konnten, auch schon ein Flop prophezeit: „Das gehört nicht an die Staatsoper ...“ Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Werke, die das Genre der Oper begründet haben, gehören nicht in die Oper! Karajan war bekanntlich anderer Meinung.
Die größte Finalszene
Wir müssen zum Ende kommen, habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Ja, die „Dialogues des Carmélites“. Es ist die letzte Neuproduktion der nächsten Spielzeit. Eines der entscheidenden Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, an der Staatsoper 1959 produziert und mehrere Jahre lang sehr viel gespielt, auch das übrigens in Karajans Direktionszeit. Das Buch beruht auf historisch verbrieften Ereignissen: 1794, also während der Französischen Revolution, gingen sechzehn Nonnen aus Compiègne singend in den Tod.
Das Finale ist eine der größten Szenen der ganzen Opernliteratur: Die Nonnen singen das „Salve Regina“, und jedes Mal, wenn die Guillotine fällt, ist eine Stimme weniger zu hören. Francis Poulenc, einer der großen Einzelgänger der Musikgeschichte, hat das in seine unwiderstehliche musikalische Sprache gefasst. Vollkommen modern und doch anders als alles, was in dieser Zeit entstanden ist. Inszenieren wird eine weitere Hausdebütantin, die österreichische Regisseurin Magdalena Fuchsberger.